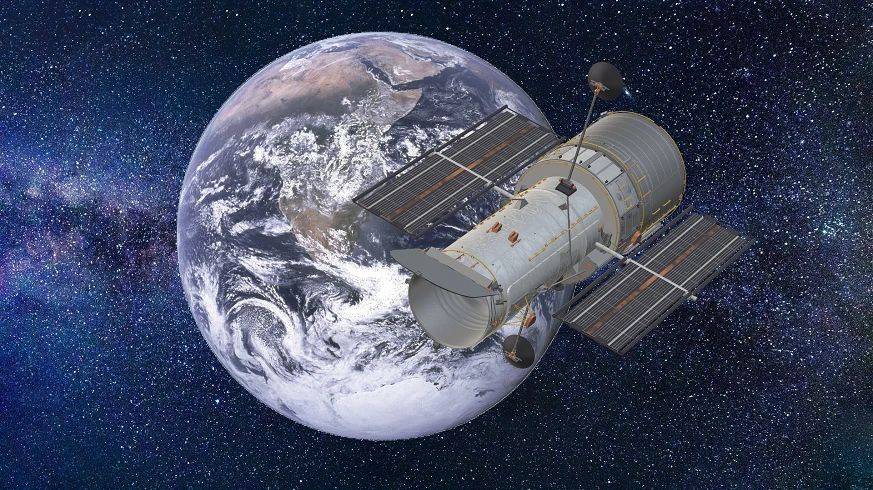EU-Chip-Gesetz: Halbleiterknappheit verringern und technologische Führungsrolle ausbauen

Interview mit Luca Bertuzzi (Redaktor für Technologie bei Euractiv) über den European Chips Act.
Welches Ziel verfolgt die Europäische Union mit dem neuen Chip-Gesetz?
Nach der COVID-19-Pandemie kam es aufgrund der steigenden Nachfrage nach mikroelektronischen Geräten zu einer weltweiten Verknappung von Halbleitern. Dieser Versorgungsengpass hatte gravierende Auswirkungen auf mehrere Industriezweige und führte beispielsweise zu monatelangen Verzögerungen bei der Autoproduktion. Die EU ist hauptsächlich von Chips abhängig, die in den Vereinigten Staaten entwickelt und in Asien hergestellt werden. Deshalb schlug die Europäische Kommission das Chip-Gesetz vor, um die europäischen Halbleiterkapazitäten in Design und Produktion zu erhöhen und gleichzeitig einen Mechanismus zur Krisenbewältigung einzuführen.
Inwieweit ist der Chips Act eine Reaktion auf den US Chips Act 2022?
Europa ist längst nicht die einzige Wirtschaftsmacht, die versucht, sich von ausländischen Halbleiterlieferungen unabhängiger zu machen. Wir haben ähnliche Bemühungen in den USA und China gesehen, weil die von der Trump-Administration eingeführten Exportbeschränkungen chinesische Tech-Giganten wie Huawei treffen. Auch Südkorea, das bereits zu den weltweit bedeutendsten Chipherstellern gehört, plant Investitionen in Höhe von 451 Milliarden Dollar, um den Wettbewerbsvorteil zu erhalten. Wenn so viel Geld auf den Tisch gelegt wird, besteht die grosse Gefahr eines Subventionswettlaufs, um grosse Chipfirmen im eigenen Land anzuziehen.
Im Vergleich zu Asien oder den USA ist die europäische Chipindustrie relativ klein. Inwieweit schafft das europäische Chip-Gesetz die notwendigen Voraussetzungen, damit Europa an der globalen Technologiespitze mithalten kann?
Europa hat noch einen langen Weg vor sich, um den technologischen Rückstand bei High-End-Chips aufzuholen. Diese hochentwickelten Technologien sind äusserst kapitalintensiv und benötigen Jahrzehnte für ihre Entwicklung. Selbst die finanziellen Mittel der grössten EU-Volkswirtschaften reichen nicht aus, um mit der internationalen Konkurrenz mitzuhalten. Gleichzeitig könnte die EU ihre Stärken ausspielen, insbesondere in Bezug auf eine weltweit führende Forschungsgemeinschaft und die Herstellung modernster Produktionsmaschinen. Die internationale Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Ländern könnte ebenfalls dazu beitragen, das Risiko dieser strategischen Abhängigkeit zu mindern.
Was entgegnen Sie auf das Argument, dass das Subventionsprogramm für die Chipindustrie nicht den wirtschaftlichen Grundprinzipien des EU-Binnenmarktes entspreche?
Es gibt ein grundlegendes Spannungsverhältnis zwischen einer aktiven Industriepolitik und den Grundsätzen des offenen Marktes, die dem europäischen Binnenmarkt zugrunde liegen. Das Chip-Gesetz bietet den Mitgliedstaaten einen Rahmen für die Gewährung staatlicher Beihilfen zur Unterstützung der heimischen Produktion – aber nur die EU-Staaten mit einem grösseren Geldbeutel werden wahrscheinlich davon profitieren. Kleinere Mitgliedsstaaten sehen keinen Vorteil darin, französische oder deutsche Technologie zu kaufen, wenn es sich nicht um die beste und günstigste handelt. Sie sehen auch die Gefahr, dass externe Abhängigkeiten durch EU-interne Abhängigkeiten ersetzt werden. Es ist unwahrscheinlich, dass diese Spannungen in nächster Zeit verschwinden werden.
In der EU gelten restriktive Beihilferegeln. Werden diese vom Chip-Gesetz eingehalten?
Die EU-Verträge erlauben eine Lockerung der Beihilfevorschriften für öffentliche Subventionen, die als strategisch sensibel gelten und die Voraussetzung für eine Investition schaffen, die sonst nicht getätigt würde. Das Chip-Gesetz gibt der Kommission einen Rahmen mit festgelegten Kriterien, um von Fall zu Fall einzeln beurteilen zu können. In diesem Zusammenhang führt das Chip-Gesetz Erstanlagen ein, die auch als Megafabriken bezeichnet werden. Dabei handelt es sich um Produktions- oder Designstandorte, die den technologischen Stand Europas erheblich voranbringen. Die langfristige Nachhaltigkeit der Investition ist ein weiterer wichtiger Faktor, der berücksichtigt wird.